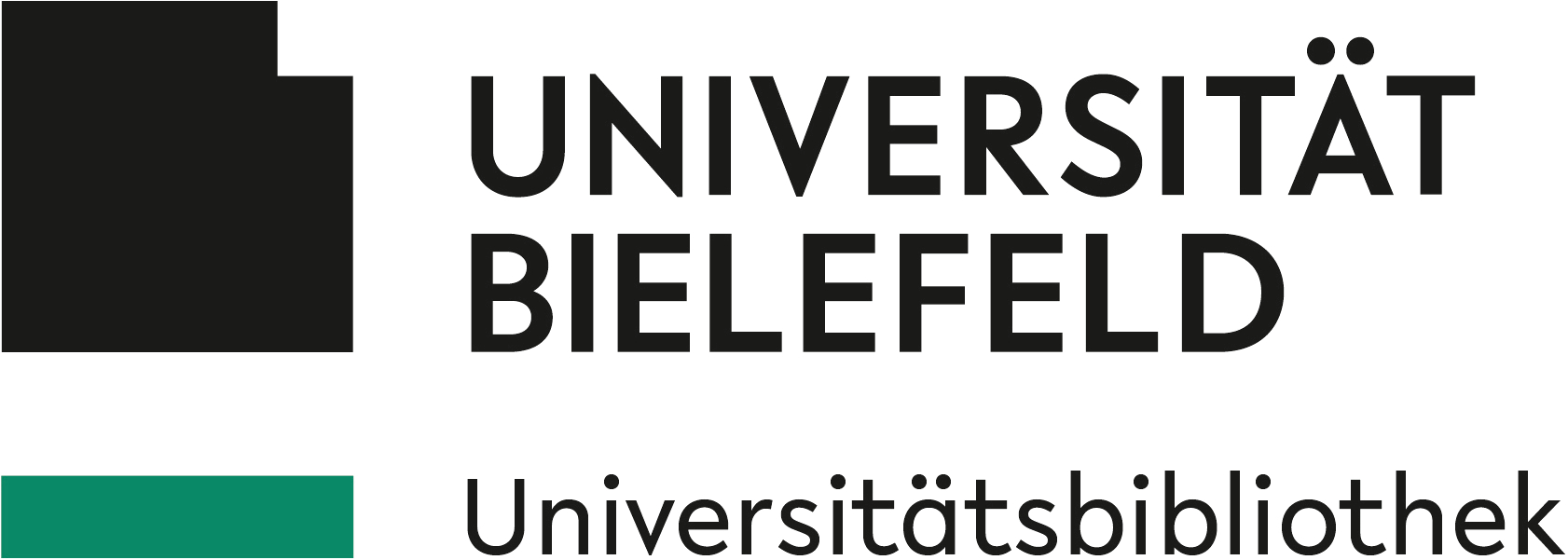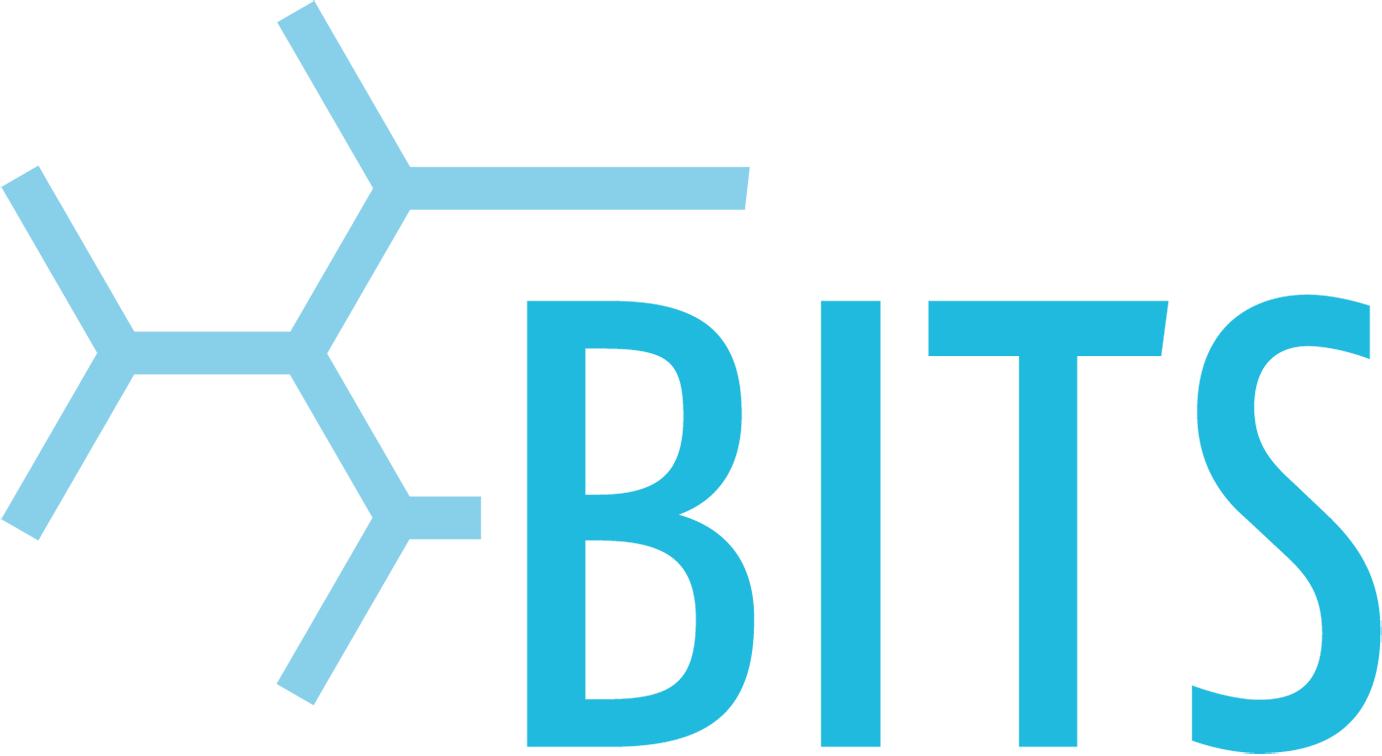Woche der Forschungskompetenzen
Aktuelle Veranstaltung (2025)
Die Woche der Forschungskompetenzen (WoFoKo) wurde 2025 bereits zum dritten Mal vom Kompetenzzentrum Forschungsdaten, dem Servicezentrum Medical Data Science und den Scientific Data Services (SDS) veranstaltet.
Die WoFoKo richtet sich an junge, aber auch erfahrene Wissenschaftler*innen aller Fachbereiche der Universität Bielefeld. Das Angebot dient der Kompetenzerweiterung für (empirisch) Forschende und umfasst Beiträge zu:
- Projektmanagement und Konfliktmanagement
- Datenschutz und Informationssicherheit
- Rechte an Daten
- Ethik der Datenerhebung
- Forschungsdatenmanagement
- Wissenschaftliches Schreiben und Publikationswesen
- Open Educational Resources
- Data Literacy & Open Data
- Forschungsförderung
- Forschen und gesund bleiben
- KI in der Forschung
Programm
Update vom 02.12.2025: Den Link zu den Vortragsfolien, die uns vorliegen, finden Sie am Ende des Textes zur jeweiligen Veranstaltung. Nicht zu allen Veranstaltungen gibt es Vortragsfolien.
- Auftakt und Begrüßung / Open Science (N. Schönfelder & K. Weiß)
11.00 - 12.30 Uhr:
Auftakt und Begrüßung / Open ScienceNina Schönfelder (Open-Science-Beauftragte der Universität Bielefeld), Katharina Weiß (Open Science Network, Scientific Data Services & BiCDaS)
In der Auftaktveranstaltung zur „Woche der Forschungskompetenzen“ werden Katharina Weiß und Nina Schönfelder „Open Science“ als Konzept sowie seine Verankerung an der Universität Bielefeld vorstellen. Open Science umfasst die Aspekte Open Access, Open Research Data, Open Source Software sowie Open Educational Resources, um nur einige zu nennen. Open Science ist kein Selbstzweck, sondern der Versuch sich wissenschaftlichen Idealen anzunähern. An der Universität Bielefeld werden Praktiken der offenen Wissenschaft an vielen Stellen gelebt. Vernetzt sind Wissenschaftler*innen sowie Vertreter*innen von Servicebereichen im „Open Science Network“. Kompetenzvermittlung an Studierende findet über das regelmäßig stattfindende Seminar „Open Science for Open Minds“ statt, an dem Dozent*innen aus vielen unterschiedlichen Fach- und Servicebereichen beteiligt sind. Dieses Seminar als auch das „Open Science Kick-Off“ jeweils zum Semesterstart organisiert das Bielefeld Center for Data Science (BiCDaS) in Kooperation mit dem Open Science Network. Schon 2005 verabschiedete die Universität eine Open-Access-Resolution, gefolgt von einer Resolution zum Forschungsdatenmanagement und einer Policy für Open Educational Resources. Des Weiteren bietet die Universitätsbibliothek Bielefeld zahlreiche Dienste an, die offene Wissenschaftspraktiken unterstützen.
Moderation: Kurt Salentin / Markus Rump
- Mögliche Stolpersteine in der Promotion und Bewältigungsstrategien (K. Koopmann)
13.30 – 15.00 Uhr:
Mögliche Stolpersteine in der Promotion und Bewältigungsstrategien
Kerstin Koopmann (Wissenschaftsmanagerin Promotionsprogramm, Fakultät für Rechtswissenschaft)Ein Dissertationsprojekt verläuft meist nicht linear, sondern ist geprägt von Höhen und Tiefen. Der Vortrag beleuchtet die 15 häufigsten Herausforderungen, denen Promovierende während ihrer Forschungsarbeit begegnen. Dazu gehören u. a. Probleme im Zeitmanagement, finanzielle Unsicherheiten, Materialchaos, Angst vor dem weißen Blatt, Perfektionismus und Prokrastination, Isolation und Motivationsverlust bis hin zu Abbruchgedanken. Der Bogen der Themen wird gespannt vom Finden einer geeigneten Forschungsfrage bis hin zur sog. Abschlusskrise.
Der Vortrag bietet einen umfassenden Überblick über bewährte Strategien zur Überwindung dieser Hürden, einschließlich praktischer Tipps. Ziel ist es, Promovierenden Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie dabei unterstützen, ihre Promotion in angemessener Zeit, erfolgreich und gesund zu meistern.
Moderation: Kristina Grüttemeier
- Informationssicherheit am Arbeitsplatz (J. Neufeld)
15.15 – 16.45 Uhr:
Informationssicherheit am Arbeitsplatz
Jari-Alex Neufeld (Teamleitung Datenschutz- und Informationssicherheitsmanagement)Die Veranstaltung vermittelt wichtiges Basiswissen und zeigt praktische Möglichkeiten auf, wie im Arbeitsalltag durch einfache Maßnahmen die Sicherheit der Daten wesentlich verbessert werden kann.
- Grundlagen der Informationssicherheit
- Der sichere Arbeitsplatz
- Sichere Handhabung von Daten
- Passworte - sicher und einfach merken
- Verschlüsselung
- Sichere E-Mail Nutzung / E-Mail-Betrug erkennen und behandeln
- Was zu tun ist, wenn doch etwas passiert
- Tipps und Tricks (auch) für den privaten Bereich
Ziel der Veranstaltung ist es, den Teilnehmenden Kompetenzen zu vermitteln, die eine angemessene Selbstverteidigung im digitalen Raum ermöglichen.
Moderation: Kurt Salentin
- Wie schreibe ich erfolgreich meinen (ersten) Drittmittelantrag? (N. Heinrichs)
09.15 - 10.45 Uhr:
Wie schreibe ich erfolgreich meinen (ersten) Drittmittelantrag?
Nina Heinrichs (Professur für Klinische Kinder- und Jugendlichenpsychologie und Psychotherapie an der Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft der Universität Bielefeld)In allen Qualifikationsphasen spielt der Erwerb von Drittmitteln eine zentrale Rolle. Wie schreibe ich solche Anträge, was muss ich berücksichtigen, welche Drittmittelförderer und Förderformate gibt es, wie wähle ich diese aus? Solche Fragen sollen in dem Vortrag angesprochen werden. Der Vortrag fokussiert auf Förderformate der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Es werden grundlegende Themen behandelt (z. B. die Bedeutung der theoretischen Fundierung der Fragestellungen, die Rolle von Vorarbeiten), die für die Wahrscheinlichkeit einer positiven Beurteilung eines Drittmittelantrags von hoher Bedeutung sind. Der Workshop richtet sich an junge Wissenschaftler*innen (Doktorand*innen, Postdocs), die eine Projektidee haben, für die sie eine Förderung suchen oder die in einem laufenden Projekt Anschlussfinanzierungen beantragen wollen.
Moderation: Kurt Salentin
- Forschungsdaten nutzen und verwalten (J. Vompras)
11.00 - 12.30 Uhr:
Forschungsdaten nutzen und verwalten
Johanna Vompras (Kompetenzzentrum Forschungsdaten)Neben der eigenen Erhebung von Forschungsdaten ist auch die Nachnutzung „fremder“ Daten in der Forschung üblich. Über Möglichkeiten, wie Forschungsdaten gefunden und nachgenutzt werden können, klärt dieser Vortrag auf. Darüber hinaus erfahren Teilnehmende etwas über die Organisation und Dokumentation von Forschungsdaten – ein Aspekt, der selbst erhobene Daten und nachgenutzte Daten gleichermaßen betrifft.
Moderation: Anne Gärtner
- From Data to Insights: An Introduction to de.NBI, ELIXIR Germany, and Cloud Computing with SimpleVM (D. Wibberg/V. Rudko)
13.30 – 15.00 Uhr:
From Data to Insights: An Introduction to de.NBI, ELIXIR Germany, and Cloud Computing with SimpleVM
Daniel Wibberg (Trainer and Training Coordinator, German Network for Bioinformatics Infrastructure (de.NBI)), Viktor Rudko (ITB, Development de.NBI Cloud & SimpleVM, Administration de.NBI Cloud Bielefeld)The German Network for Bioinformatics Infrastructure (de.NBI) provides a comprehensive platform for life sciences research, offering high-quality bioinformatics services, training programs, and cloud computing resources. As the national hub for bioinformatics in Germany, de.NBI supports over 150 active members across eight service centers and operates as ELIXIR Germany, representing the German Node within the European ELIXIR infrastructure. The network is coordinated by the Forschungszentrum Jülich GmbH branch office at Bielefeld University.
In this workshop, we will give you an introduction to de.NBI and ELIXIR Germany, highlighting the benefits of these initiatives for life sciences research. We will then provide an introduction to the de.NBI Cloud using SimpleVM, a user-friendly platform that allows researchers to easily access and utilize computational resources.
Through demo sessions, participants will learn how to:
- Access the de.NBI Cloud
- Use SimpleVM to launch virtual machines and ready-to-use applications, including RStudio, VSCode and a remote Linux Desktop
- Streamline a cloud-based training via the SimpleVM Workshop mode
By the end of the session, participants will gain an overview of how to leverage the power of de.NBI and ELIXIR Germany to accelerate their research and teaching activities.
Moderation: Katharina Weiß
- Einführung in das wissenschaftliche Publikationswesen (K. Salentin)
15.15 – 16.45 Uhr:
Einführung in das wissenschaftliche Publikationswesen
Kurt Salentin (Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung)Zielgruppe: Junge Autor*innen in der Wissenschaft
Der Vortrag vermittelt Orientierung in einem unübersichtlichen Publikationsmarkt:- Was eine wissenschaftliche Publikation ausmacht: Qualitätssicherungsmechanismen
- das Interessenspektrum: Autor*innen, scientific community, Verlage
- verlegerische Geschäftsmodelle
- Kosten für Autor*innen, Leser*innen, Redaktionen und Einrichtungen
- Lizenzmodelle und Verwertungsrechte
- Fehlentwicklungen und Fallen
Moderation: Anne Gärtner
- Datenschutz: Überblick über die an der Universität verwendeten Formulare und Muster (R. Elenbogen/A. Schmid)
09.15 - 10.45 Uhr:
Datenschutz: Überblick über die an der Universität verwendeten Formulare und Muster
Roman Elenbogen (Datenschutzmanager), Anja Schmid (behördliche Datenschutzbeauftragte)Die Universität Bielefeld stellt ihren Forschenden eine Reihe von Formularen und Mustern zur Verfügung, um eine datenschutzkonforme Forschung zu ermöglichen. In diesem Vortrag werden die an der Universität verwendeten Unterlagen vorgestellt und deren Anwendungsfälle erläutert. Der Vortrag baut fachlich auf dem Vortrag "Datenschutz: Einwilligungen und Datenschutzerklärungen" auf, geht aber stärker auf weitere Anforderungen des Datenschutzes ein, wie z.B.: Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT), Datenschutzkonzepte, AV-Verträge, Datenschutzfolgenabschätzungen, Vereinbarungen zur gemeinsamen Verantwortlichkeit usw.
Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, bei einer Q&A-Runde Fragen an die Datenschutzbeauftragte der Universität zu stellen.
Moderation: Kristina Grüttemeier
- Q&A: Rechtlicher Schutz von Forschungsdaten (D. Barber)
11.00 - 12.30 Uhr:
Q&A: Rechtlicher Schutz von Forschungsdaten
David Barber (Dez. Studium und Lehre / Justiziar)Rechtliche Fragen zum Schutz von Forschungsdaten berühren gleich mehrere Rechtsgebiete (z.B. Urheberrecht, gewerblicher Rechtsschutz, Datenschutz, Arbeitsrecht) und müssen oft auch abhängig von der jeweiligen Zugehörigkeit zu einer universitären Statusgruppe betrachtet werden.
Nach einer kurzen rechtlichen Einordnung (auf Grundlage der Handreichungen „Rechtlicher Umgang mit Forschungsdaten im Hochschulwesen“, zugänglich über das Uni-Netz / VPN) haben die Zuhörer*innen die Möglichkeit, ihre persönlichen Fragen zum rechtlichen Umgang mit Forschungsdaten zu stellen und mit dem Referenten und anderen Teilnehmer*innen zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen.
Fragen können gerne auch bereits im Voraus an den Referenten (david.barber@uni-bielefeld.de) gerichtet werden.
Moderation: Felicitas Wagner
- Ethik der Datenerhebung: Ziele und Verfahren forschungsethischer Beratung und Begutachtung (E. Berens)
13.30 - 15.00 Uhr:
Ethik der Datenerhebung: Ziele und Verfahren forschungsethischer Beratung und BegutachtungEva Berens (Ethik-Kommission der Univ. Bielefeld)
Zielgruppe: Junge, aber auch erfahrene Wissenschaftler*innen aller Fachbereiche der Universität Bielefeld in der empirischen Forschung an und mit Menschen
Lernziele:
- Die Teilnehmenden können forschungsethisch sensible Aspekte beim Studiendesign und in der Datenerhebung erkennen und reflektieren (Einführung in forschungsethische Herausforderungen bei der Datenerhebung/Studiendesign)
- Sie sind in der Lage zu entscheiden, ob eine forschungsethische Begutachtung für ihr Vorhaben notwendig ist bzw. sinnvoll erscheint (Gründe für eine forschungsethische Begutachtung von Datenerhebungen)
- Sie kennen die vorhandenen Beratungs- und Begutachtungsprozesse (Vorstellung der Aufgaben der Ethik-Kommission der Universität Bielefeld (EUB) und des Verfahrens der forschungsethischen Begutachtung durch die EUB)
- Sie sind sich der Abgrenzung und Überschneidungen von Forschungsethik und Datenschutz bewusst (Abgrenzung Forschungsethik und Datenschutz)
- Sie kennen die Anforderungen an eine informierte Einwilligung in die Teilnahme an Forschungsprojekten (Einführung in Grundlagen der informierten Einwilligung und Vorstellung der Aufklärungsvorlagen der Uni Bielefeld)
- Zudem wird ein Austausch zu aktuellen Fragen und Themen aus den Fachgebieten in die Veranstaltung integriert.
Es sind keine vorbereitenden Materialien notwendig. Informationen können auf der Webseite der Ethik-Kommission eingesehen werden.
Moderation: Katharina Weiß
- Gemeinsam f̶o̶r̶s̶c̶h̶t̶ lehrt man weniger allein (F. Homp)
15.15 – 16.45 Uhr:
Gemeinsamforschtlehrt man weniger allein. Warum es sich lohnt, Lehre wie Forschung zu denken – offen, kollaborativ und anschlussfähig.Frank Homp (Jöran & Konsorten – Agentur für zeitgemäße Bildung)
Kurzbeschreibung: Wer lehrt, erfindet das Rad oft neu – und das meist allein. Im Gegensatz zur Forschung, wo Austausch, Kooperation und Sichtbarkeit Standard sind, bleibt Lehre häufig im Verborgenen. Das kostet Zeit, Energie und manchmal auch Nerven.
In diesem Workshop diskutieren wir, wie Lehre sichtbarer, effizienter und zugleich kollaborativer gestaltet werden kann – ohne Mehraufwand. Wir schauen uns an, wie man von anderen Lehrenden lernen kann, wie eigene Materialien strukturiert weitergegeben werden können, und was das alles mit Forschung zu tun hat. Spoiler: Es geht auch um Open Educational Resources (OER) – aber erst später.
Ziele: Nach dem Workshop:
- haben die Teilnehmer:innen mindestens einmal gelacht, 😂
- waren die Teilnehmer:innen mindestens einmal irritiert, 🤨
außerdem:
- sind sich die Teilnehmenden zentraler Herausforderungen bei der Materialerstellung und -nutzung ihrer Lehre (und der ihrer Kolleg:innen) bewusst,
- erkennen sie Chancen durch geteilte Lehre und Austausch unter Lehrenden (nicht gleich mit der Welt aber vielleicht in der Fakultät?),
- verstehen sie die Grundidee von OER und Open Educational Practices,
- entwickeln sie erste Ideen, wie sie ihre eigene Lehre effizienter, sichtbarer oder anschlussfähiger gestalten können – ggf. auch im Zusammenspiel mit ihrer Forschung.
Format: Der Workshop ist interaktiv angelegt: Kurzer Impuls, offene Fragen, kollegialer Austausch. Eigene Beispiele oder aktuelle Lehrherausforderungen dürfen gern eingebracht werden.
Speaker: Frank Homp ist Bildungsgestalter bei Jöran & Konsorten (J&K), einer Hamburger Agentur für zeitgemäße Bildung. Dort beschäftigt er sich unter anderem mit offenen Bildungspraktiken (wie z. B. dem OERcamp), dem Teilen von Wissen und der Frage, warum Lehre oft isolierter gedacht wird als z. B. Forschung. Sein Schwerpunkt: Open Educational Resources – oder, wie er selbst sagt, "die Idee hinter den drei Buchstaben, bevor sie jemand abschreckt". Davor war Frank u. a. Soldat, Physiotherapeut, Bildungswissenschaftler und Hochschuldidaktiker – und ist jetzt vor allem eines: ein leidenschaftlicher Mitgestalter einer offenen Bildungskultur.
Moderation: Felicitas Wagner
- Einführung in das Projektmanagement (N. Reschke)
09.15 – 10.45 Uhr:
Einführung in das Projektmanagement
Nils Reschke (Live Online Trainer/Moderator, Bonn)Der Vortrag stellt die Methodik sowie zentrale Aufgaben des Managements wissenschaftlicher Projekte vor. Folgende Themen werden behandelt:
- Besonderheiten und Erfolgsfaktoren von Forschungsprojekten
- Projektphasen und -ziele
- Rollen und Verantwortlichkeiten von Projektleitung und Team
- Techniken systematischer Projektplanung
Die Teilnehmenden erhalten Einblick in die Planung und Durchführung wissenschaftlicher Projekte und lernen dadurch die Herausforderungen eigener Projekte einzuschätzen und zu meistern. Darüber hinaus erhalten Sie eine kurze Einführung, wie sie mithilfe bereitgestellter Materialien eigene Forschungsprojekte gezielt planen und durchführen können.
Moderation: Johanna Vompras
- Schreiben – und Denken – im Forschen (S. Haacke-Werron/B. Angerer)
11.00 - 12.30 Uhr:
Schreiben – und Denken – im Forschen
Stefanie Haacke-Werron (Schreiblabor, Zentrum für Lehren und Lernen), Benjamin Angerer (Zentrum für Lehren und Lernen)„Ohne Schreiben kann man nicht denken, jedenfalls nicht in anspruchsvollen, selektiven Zugriff aufs Gedächtnis voraussehenden Zusammenhängen. Das heißt auch: Ohne Differenzen einzukerben, kann man nicht denken.“
Bei diesen Sätzen handelt es sich um eine ad hoc Notiz in Niklas Luhmanns Zettelkasten (ZK II, Zettel 9/8g). Der vergilbte, mit der handschriftlichen Notiz versehene Zettel wirkt wie ein Objekt aus längst vergangenen Zeiten. Doch trotz ihres Alters ist diese Notiz aktuell. Das ist zumindest die Vorannahme und These, die den hier angekündigten Input und Austausch motiviert: Wissenschaftliches Denken, d. h. gedankliche Verknüpfungen von Daten, Fragestellung und einschlägiger Literatur sind erst wirklich ‚da‘, wenn sie in Sprache, also in Sätzen, oder in Formeln, Grafiken oder Skizzen formuliert worden sind. Entsprechend wird der Input auf das „Denken“ im Prozess der Forschung eingehen und Praktiken wie die des luhmannschen Zettelkastens als individualisierte Kulturtechniken betrachten, die in den letzten Jahrzehnten in der Ratgeberliteratur verallgemeinert und zunehmend auch von der Softwareindustrie aufgegriffen und durch digitalen Mindmapping-, Brainstorming- und Literaturverwaltungs- sowie Wissensmanagementprogramme wie Endnote, Zotero und Citavi breit zugänglich gemacht worden sind. Und nun ist auch generative KI verfügbar ...
Die 90-minütige Zoom-Sitzung will einen Austausch der Teilnehmenden anstoßen, der sich an folgenden Fragen orientiert: Welche digitalen oder analogen Techniken nutzen Sie in Ihrem Forschungsprozess, und welche Rolle spielen diese Techniken für Ihr Verständnis dieses Prozesses? Welche handwerklichen Formen haben Sie für das Denken im Forschen gefunden? Und: Gibt es technische Lösungen für die Reduzierung der Unsicherheiten, die ergebnisoffenes Forschen mit sich bringt?
Moderation: Markus Rump
- KI-Nutzung in der Forschung (B. Paaßen)
13.30 - 15.00 Uhr:
KI-Nutzung in der Forschung
Benjamin Paaßen (Technische Fakultät, Universität Bielefeld)Die zunehmende Verbreitung großer Sprachmodelle wie GPT4o hat in der Forschung zu zahlreichen neuen Ideen für Forschungsmethoden geführt. Dabei ist die Assistenz beim Schreiben wissenschaftlicher Publikationen bloß der Anfang. Sprachmodelle werden längst auch eingesetzt, um im großen Stil Daten zu annotieren, systematische Literaturrecherchen durchzuführen, Daten auszuwerten, Modelle zu evaluieren und sogar menschliches Verhalten zu simulieren, statt mit menschlichen Versuchspersonen zu forschen.
Im Beitrag wird Benjamin Paaßen Beispiele für die Nutzung von Sprachmodellen in der Forschung zeigen und im Hinblick auf gute wissenschaftliche Praxis diskutieren.
Benjamin Paaßen ist Juniorprofessor für Wissensrepräsentation und Maschinelles Lernen an der Technischen Fakultät. Im Rahmen der Projekte SAIL und KI-Akademie befasst sich die Arbeitsgruppe mit den Potenzialen und Limitationen großer Sprachmodelle in Forschung und Lehre.
Moderation: Katharina Weiß
- Getting Started in Research Funding (M. Gartzlaff/L. Gumpert)
15.15 – 16.45 Uhr:
Getting Started in Research Funding
Minea Gartzlaff, Lena Gumpert (both Dep. for Research Administration and Technology Transfer (FFT), Bielefeld University)This presentation is aimed at (advanced) doctoral students and postdocs who wish to apply for external funding and/or obtain initial ideas and information in this regard. Basic general information on the funding landscape will be given and important national third-party funding bodies will be presented: the German Research Foundation (DFG), the Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and an exemplary selection of research-funding foundations. In addition, the importance of acquiring third-party funding for an academic career will be discussed.
The presentation will be given in English. In the subsequent discussion, questions in German are possible and welcome.
Moderation: Anne Gärtner
- Datenschutz in der Forschung: Einwilligungserklärungen (A. Gärtner/M. Rump)
09:15 - 10:45 Uhr:
Datenschutz in der Forschung: EinwilligungserklärungenAnne Gärtner, Markus Rump (Kompetenzzentrum Forschungsdaten)
In zahlreichen Disziplinen werden personenbezogene Forschungsdaten erhoben. Aber was sind eigentlich personenbezogene Daten und wann dürfen sie im Rahmen der Forschung erhoben und verarbeitet werden? In diesem Vortrag lernen die Teilnehmenden die Grundlagen des Datenschutzes, die damit verbundenen rechtlichen Anforderungen sowie den Umgang mit personenbezogenen Daten kennen. Außerdem lernen sie, welche Inhalte eine Informierte Einwilligungserklärung enthalten sollte und wie sie eine solche für ihr Forschungsprojekt erstellen können.
Moderation: Johanna Vompras
- Macht(missbrauch) in der Wissenschaft (S. Hohmann)
11.00 – 12.30 Uhr:
Macht(missbrauch) in der WissenschaftSophia Hohmann (Netzwerk gegen Machtmissbrauch in der Wissenschaft e.V.)
In der Wissenschaft ist die Einhaltung guter wissenschaftlicher Praxis von zentraler Bedeutung, um die Integrität, Qualität und Glaubwürdigkeit der Forschung zu gewährleisten. Im DFG-Kodex zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis heißt es, dass Machtmissbrauch zu verhindern sei. Was genau unter Machtmissbrauch zu verstehen ist und was nicht, wird jedoch nicht erläutert.
In diesem Workshop nähern wir uns dem Phänomen Machtmissbrauch in der Wissenschaft aus macht- und diskriminierungskritischer Perspektive. Im Fokus stehen dabei die eigene Rolle als Forscher*in sowie die multiplen Abhängigkeitsbeziehungen, in denen Forscher*innen stehen (können). Anhand von Fallbeispielen erkunden wir die Vielfalt von Machtmissbrauch in der Wissenschaft. Außerdem werden verschiedene Handlungsoptionen thematisiert. Während des Workshops gibt es die Möglichkeit, anonym Fragen zu stellen.
Sophia Hohmann engagiert sich im „Netzwerk gegen Machtmissbrauch in der Wissenschaft e. V.“ (MaWi).
Moderation: Johanna Vompras
- Research in Balance: Health as a Key Competence in Academia (Z. Deptolla/M. Huwendiek)
13.30 – 15.00 Uhr:
Research in Balance: Health as a Key Competence in Academia
Zita Deptolla, Mats Huwendiek (Health Management, Bielefeld University)
Health is a key resource in everyday research, essential for remaining both productive and motivated in the long term. This talk presents recent survey findings from the “Bielefeld Questionnaire on Working and Study Conditions,” highlighting how organizational frameworks shape researchers’ well-being and health, and introduces support services offered at Bielefeld University. At its core, the session asks how health can be understood and strengthened as an integral part of research competence. Following a one-hour input, we invite participants to share their own positive and negative experiences from academic life in an open discussion.
Moderation: Felicitas Wagner
Ihr Feedback
Bitte senden Sie uns Kommentare, Kritik und Anregungen zur Veranstaltung:
- per E-Mail an data@uni-bielefeld.de
- oder gerne anonym über den folgenden Link: https://www.menti.com/alqxmmz8jxsa.
Organisation und Unterstützung
Hintergrund
- Warum eine "Woche der Forschungskompetenzen"?
Die Forschung an Universitäten ist tiefgreifenden Entwicklungen ausgesetzt: fortschreitender Digitalisierung, gestiegener Evidenzorientierung, einer Verrechtlichung, auch über den Datenschutz hinaus, einem unübersichtlicher werdenden Publikationsmarkt, hoher Personalfluktuation in drittmittelgeförderten Projekten, einer kompetitiv gestalteten Hochschullandschaft. Neue Disziplinen wie die Digital Humanities entstehen, neue Datenquellen werden täglich erschlossen. Daten wandeln sich zu einer auch ökonomisch bedeutsamen Ressource. Die Veränderungen der Forschung verlangen nach neuen Kompetenzen.
In einem gewissen Maß vollziehen die Universitäten diesen Wandel nach. In zweifacher Hinsicht klafft aber eine Lücke zwischen Kompetenzerfordernissen und -verfügbarkeit:
Bereits in der Ausbildung müssten Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden, die dem fachgerechten Umgang mit Daten entsprechen. Zwar wächst das Angebot an Lehrveranstaltungen in Datenerhebung und -analyse, aber Data Literacy muss wesentlich weiter gefasst werden. Dabei sind Curricula behäbig. Auch wenn das Studium nicht mit einer Berufsausbildung zu vergleichen ist, lässt sich Praxisorientierung nicht ohne Kompetenzen etwa in Datenschutz und Informationssicherheit vorstellen. Die Woche der Forschungskompetenzen soll helfen diese Lücke zu schließen, indem sie jungen ForscherInnen mit dem kleinen Einmaleins in ausgewählten Feldern vertraut macht.
Manche Entscheider in der Organisationsentwicklung haben erkannt, dass eine funktionale Ausdifferenzierung fachkompetenter Rollen forciert werden muss. Daher haben wir heute etwa einen Informationssicherheitsbeauftragten und Drittmittelakquise-Beratungsdienste, und in den Bibliotheken, die sich einer Umwälzung ihres Anforderungsprofils unterworfen sehen, findet der Wandel in der Einrichtung von Daten-Repositorien einen Ausdruck. Doch die damit verbundene Umschichtung von Ressourcen bereitet in gewachsenen Organisationsstrukturen immer Probleme. Mit dem Tempo der Veränderungen können große Organisationen kaum Schritt halten. Deshalb übersteigt der schiere Umfang des Beratungsbedarfs infolge eng getakteter Datenerhebungen mit unablässig wechselndem Personal die Kapazität mancher inzwischen eingerichteter formeller Beratungsangebote. Der Kompetenzaufbau bei den Forschenden soll hier zu einer Entlastung beitragen, indem sie die Schwelle der Problemkomplexität erhöht, von der an eine Inanspruchnahme notwendig wird. Nicht zuletzt soll die Woche dazu beitragen, die Diskussion um notwendige Veränderung in Gang zu halten.
Archiv
Frühere Veranstaltungen finden Sie im Archiv.